Neurochirurgische Wirbelsäulenchirurgie
Im Schwerpunkt Neurochirurgische Wirbelsäulenchirurgie beschäftigt sich unser Spezialisten–Team mit der Diagnosestellung und der Therapie des gesamten Spektrums von Wirbelsäulenerkrankungen. Besondere therapeutische und wissenschaftliche Expertise besteht im Bereich der degenerativen und tumorbedingten Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Das optimale Management dieser Erkrankungen erfordert einen interdisziplinären Ansatz. Hierzu pflegen wir eine enge Kooperation mit den jeweiligen Spezialist*innen des Universitätsklinikums.
Die Klinik für Neurochirurgie ist ein Teil des Wirbelsäulen Zentrums am UKM und von der Deutschen Wirbelsäulen Gesellschaft (DWG) als Wirbelsäulenzentrum der höchsten Stufe, Level 1 zertifiziert.
Die Sektion für spinale Neurochirurgie des Universitätsklinikums Münster bietet ein modernes, vollständiges Spektrum der Diagnostik und Therapie auf höchstem Niveau unter Verwendung minimalinvasiver Techniken und modernster Technologie.
Als universitäres neurochirurgisches Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie beschäftigen wir uns intensiv mit Forschung und Lehre. Eine ständige Weiterbildung im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie halten wir für selbstverständlich. Hierzu pflegen wir gemeinsam mit anderen Kliniken aus Münster und Umgebung einen regelmäßigen interdiziplinären Wirbelsäulenqaulitätszirkel.
Sprechstunde für Wirbelsäulenchirurgie
Ort: NCH Ambulanz
Zeit: Montag, 9.00–15.00 Uhr und Dienstag, 9.00–15.00 Uhr
Experten: Priv.-Doz. Dr. med. Michael Schwake, Dr. med. Nils Warneke
Anmeldung: +49 251 83-47489
nch-poliklinik(at)ukmuenster.de
In Notfällen erreichen Sie unseren neurochirurgischen Dienstarzt oder unsere neurochirurgische Dienstärztin jederzeit unter +49 251 83-55555.
Privatsprechstunde: Montag, 13.00–18.00 Uhr und Mittwoch, 8.00–14.00 Uhr
Krankheitsbilder
Wir versorgen folgende Krankheitsbilder:
Zu den degenerativen Erkrankungen der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule zählen u. a. das Bandscheibenleiden (z. B.: Bandscheibenvorfall), die Einengung des Spinalkanals (Spinalkanal-Stenose), das Wirbelgleiten (Spondyloslisthesis) und sonstige Verschleißerkrankung der Wirbelsäule (z.B.: Osteochondrose, Facettengelenksarthrose, altersbedingte Deformität, OPLL, FISH, M. Forstier).
Die häufigsten Tumorerkrankungen der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule haben ihren Ursprung entweder direkt in der Wirbelsäule, dem Rückenmark (z.B.: Ependymome, Astrozytome, Hämangioblastome) und seinen Hüllstrukturen (z.B.: Menigeome, Neurinome) oder sind als Tochtergeschwulst bereits als eine Absiedlung (Metastase) von Tumoren zu sehen, die ihren ursprünglichen Sitz, an einem anderen Ort im Körper haben.
Die durch Erreger bedingten entzündlichen Erkrankungen der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule befallen die Bandscheibe (Diszitis), den Wirbelkörper (Spondylitis), den Spinalkanal (z. B. als epiduraler Abszess), die umgebenden Weichteile oder eine Kombination daraus (Spondylodiszitis). Von der infektiös bedingten Entzündung muss die rheumatoide Arthritis und die chronische, entzündlich-rheumatische Erkrankung der Wirbelsäule (z.B. Morbus Bechterew, Spondylitis ankylosans) unterschieden werden.
Desweitern können Gefäßmissbildungen (z.B. durale arterio-venöse Fisteln, arterio-venöse Malformationen und Cavernome) Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule verursachen. Bei diesen Erkrankungen müssen in der Regel intensive Untersuchungen durchgeführt werden wie z.B. eine Angiographie. Eine Behandlung erfolgt in der Regel interdisziplinär, gemeinsam mit den Kolleg*innen der Interventionellen Neuroradiologie.
Den Verletzungen der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule geht meist eine mehr oder minder starke Gewalteinwirkung voraus, die mit einer solchen Kraft auf die Wirbelsäule einwirkt, dass diese ihr nicht standhalten kann und nachgibt bzw. bricht. Dieses Nachgeben kann auch im Rahmen der altersbedingten Knochenerweichung (Osteoporose/Osteopenie) auftreten. In einem solchen Fall bedarf es meist keiner großen Krafteinwirkung. Je nach Ausmaß der Krafteinwirkung kommt es zur Mitverletzung des Rückenmarks und/oder der Nervenstrukturen.
Zu den Anlagestörungen der Wirbelsäule zählen insbesondere Bogenschlussstörungen mit und ohne Myelomeningocelen. Desweitern ist vor allem das Klippel-Feil-Syndrom zu benennen. Durch die spontane Fusion von Wirbelkörpern kommt es zu vermehrter Belastung und chronischen Beschwerden am Nacken.
Zu den chronischen Schmerzsyndromen der Wirbelsäule gehören neuropathische Schmerzen (Brennschmerzen), welche durch eine anhaltende Schädigung der Nerven entstehen können. Nach einer vorrausgegangenen Wirbelsäulenoperation werden diese Schmerzen auch als Failed Back Surgery Syndrom (FBSS) bezeichnet.
Behandlungsverfahren
Konservative Verfahren
Zu den konservativen Therapieverfahren zählt unter anderem die Physiotherapie, die Rückenschule, Manuelle Therapie, Osteopathie, Massage und Wasserbewegungsbäder. Die Behandlung kann ambulant und stationär im Rahmen des stationären Aufenthaltes oder im Rahmen einer Rehabilitation durchgeführt werden.
Mikrochirurgische Operationen
Bei den mikrochirurgischen Verfahren handelt es sich um Eingriffe, die mit Hilfe eines Operationsmikroskops durchgeführt werden. Dies verbessert die Sicht für den Operateur oder die Operateurin erheblich und erhöht wesentlich die Detailschärfe, wenn Operationen an den Nervenwurzeln und dem Rückenmark durchgeführt werden müssen. Dadurch senkt sich das operative Risiko deutlich. Standardmäßig kommt das Operationsmikroskop bei Eingriffen bei lumbalen, thorakalen oder zervikalen Bandscheibenvorfällen oder Spinalkanaleinengungen aber auch bei Tumoroperationen zum Einsatz.
In manchen Fällen können auch Versteifungen der Lendenwirbelsäule bei degenerativen Erkrankungen oder Frakturen minimal-invasiv erfolgen.
Minimal-invasive Verfahren
Bei den minimal-invasiven Operationen handelt es sich um spezielle Techniken, die dazu dienen, die Gewebeschichten bis zur Wirbelsäule zu schonen und Blutungen zu reduzieren. Das operative Ziel an der Wirbelsäule soll jedoch in der gleichen Effektivität angegangen wie bei den herkömmlichen offenen Eingriffen. Zu den minimal-invasiven Verfahren in der Wirbelsäulenchirurgie gehören auch die Nervenblockaden durch Facettengelenksinfiltration, Periradikuläre Therapie (PRT), Kryotherapie und Thermokoagulation der Nerven und das Verfahren der Vertebroplastie und Kyphoplastie.
Offene Operationen
Bei den offenen Operationen wird je nach vorliegender Grunderkrankung die Wirbelsäule von vorne oder/und hinten versorgt. Hierbei wird die Wirbelsäule (HWS, BWS, LWS) z. B. versteift, ein Wirbelkörper ersetzt, der Spinalkanal freigelegt, Tumoren entfernt oder – im Falle einer erheblichen Verletzung – die ursprüngliche Form wieder hergestellt.
Endoskopische Operationen
Bei den endoskopischen Operationsverfahren wird über einen Führungsdraht unter Bildwandlerkontrolle eine starre Arbeitshülse in den Spinalkanal vorgeschoben. Hierüber kommen dann die Optik und die unterschiedlichen Instrumente zum Entfernen des Bandscheibenvorfalls zum Einsatz. Somit ist lediglich ein Hautschnitt von ca. 5 mm notwendig und die Muskulatur wird geschont. Patient*innen profitieren in der Regel von einer raschen Mobilisation und schnelleren Erholungsphase.
Sonstige Therapieverfahren
Sonstige Verfahren zur Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen stellen die Implantation von Rückenmarkstimulatoren (SCS) sowie die Implantation von Medikamentenpumpen zur Schmerztherapie dar.
Nervenblockaden
Nervenblockaden können bei chronischen und bei akuten Rücken- oder Beinschmerzen helfen, den Schmerz zu durchbrechen oder genauer zu analysieren. Wir unterscheiden Nervenblockaden, die vorübergehend (kurzfristig) oder semipermanent (langfristig) wirken. Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Nervenblockade ist, dass der richtige Nerv blockiert wird. Bei einigen Patient*innen ist bereits der erste Versuch erfolgreich.
Die temporäre Nervenblockade erfolgt mit einer Kombination aus einem Lakalanästhetikum und antiphlogistischen (entzündungshemmenden) Sterodid. Nervenblockaden durch Injektion bewirken im Allgemeinen eine temporäre Schmerzlinderung. Eine mögliche Begleitreaktion kann eine vorübergehende Nervenlähmung über mehrere Stunden sein. Zur genauen Platzierung werden die Nervenblockaden unter Röntgendurchleuchtung oder in einer Computertomographieanlage durchgeführt. Hierbei führen wir folgende Nervenblockaden durch:
- Facettengelenksinfiltartion
- Periradikuläre Therapie (PRT)
- ISG-Infiltration
Eine semipermanente Nervenblockade kann durch eine lokale Zerstörung des Nerven durch Gefrieren (Kryotherapie) oder durch Hitze mittels einer Hochfrequenz-Ablation erfolgen. Hierdurch kann der Schmerz wochen- oder sogar monatelang gelindert werden, bis der Körper den Schaden repariert hat. Die Nervenblockade erfolgt im Allgemeinen ambulant. Es können Nebenwirkungen oder Komplikationen z.B. eine Infektion, allergische Reaktionen und stärkere Schmerzen auftreten.
Unser Team der Neurochirurgischen Wirbelsäulenchirurgie
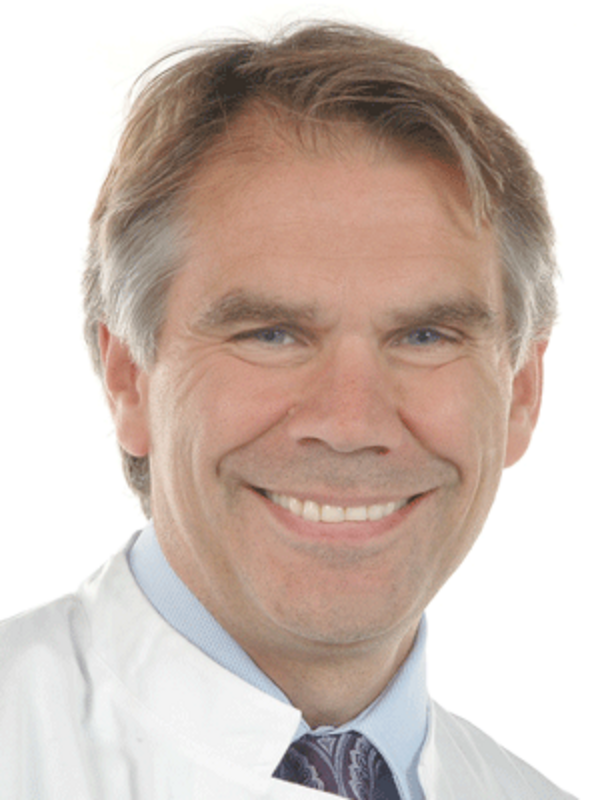
Univ.-Prof. Dr. med. Walter Stummer
Direktor Klinik für Neurochirurgie

Prof. Dr. med. Michael Schwake
Oberarzt

Dr. med. Nils Warneke
Leitender Oberarzt
Klinik für Neurochirurgie
Albert-Schweitzer-Campus 1
Gebäude A1
48149 Münster

