Kleinhirnbrückenwinkeltumore (KHBW-Tumore) und Akustikusneurinome
Im Raum zwischen dem Kleinhirn und dem Hirnstamm wächst eine Anzahl meist gutartiger Tumore. Akustikusneurinome und Meningeome sind am weitesten verbreitet. Eine wesentliche Rolle spielen überdies Epidermoide und Glomus jugulare-Tumore.
Typischerweise führen diese Prozesse erst zu Hirnnervenausfällen, später zu Hirnstammkompression und Hydrozephalus. Seit Einführung der Kernspintomographie (MRT) werden diese Tumore meistens in weniger fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert. Das primäre Ziel der Operation ist heute die Erhaltung der Hirnnervenfunktionen bei totaler oder nahezu totaler Entfernung.
Sprechstunde Schädelbasischirurgie
Ort: NCH Ambulanz
Zeit: Mittwoch, 09.00–15.00 Uhr
Experten: Univ.-Prof. Dr. med. Walter Stummer, Prof. Dr. med. Eric Suero Molina
Anmeldung: +49 251 83-47489
nch-poliklinik(at)ukmuenster.de
In Notfällen erreichen Sie unseren neurochirurgischen Dienstarzt oder unsere neurochirurgische Dienstärztin jederzeit unter +49 251 83-55555.
Akustikusneurinome werden entsprechend der Größe nach Koos eingeteilt. Diese Einteilung hat sich für die Prognose bezüglich der postoperativen Funktion der Hirnnerven VII und VIII zusätzlich zur funktionellen Ausgangslage bewährt.
Glomus jugulare-Tumore haben wie Akustikusneurinome einen lokalisierten Ursprung. Die Symptomatik hängt damit weitgehend davon ab, wie fortgeschritten das Tumorstadium ist. Die Einteilung nach Fisch hat sich zur Klassifizierung durchgesetzt.
Meningeome haben ihren Ursprung an der Felsenbeinpyramide oder dem Clivus (Teil der Schädelbasis). Extensive Meningeome, die ursprünglich vom Tentorium (Kleinhirndach aus Bindegewebe) ausgehen oder von der hinteren Begrenzung des Foramen magnum (Hinterhauptsloch) können sekundär bis in den Kleinhirnbrückenwinkel vorwachsen. Aufgrund der variablen Ursprünge sind Meningeome dieser Region eine inhomogene Gruppe.
Symptome und Aufnahmerichtlinien
Dekompensierte Kleinhirnbrückenwinkeltumore sind heute die Ausnahme. In der Regel kann die Aufnahme elektiv erfolgen. Falls es zu einer akuten Raumforderungssymptomatik der hinteren Schädelgrube mit Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen oder Bewusstseinstrübung kommt, muss notfallmäßig hospitalisiert werden. Bei der Aufnahme der Anamnese und der Eintrittsuntersuchung ist besonders auf folgende Punkte zu achten:
- Gehörverlust: Beginn, Verlauf, Ausprägung
- Fazialisparese (Gesichtsmuskellähmungen): Beginn, Ausprägung
- Sonstige Hirnnerven: Trigeminus (Gesichtsempfindung), Schluckstörungen, Sprechprobleme, Schwindel
- Ataxie (Koordinationsstörung der Rumpf-/Extremitätenbewegung): Beginn, Verlauf, gerichtete Fallneigung
- Blickparesen mit Doppelbildern, Nystagmus (feinschlägige Augenbewegungen beim Blick zu einer Seite)
- Ausfälle der langen Bahnen: halbseitige Lähmungen, Spastik, Sensibilitäts- und Lagesinnstörungen
Diagnostik
Radiologie
Die MRT ist die sensitivste Untersuchung zur Abgrenzung von Kleinhirnbrückenwinkeltumoren von den benachbarten neutralen und vaskulären Strukturen. Die Artdiagnose wird meistens mit diesem Instrument gestellt. Probleme bereiten immer noch Epidermoide, die schlecht von anderen zystischen Raumforderungen abgegrenzt werden können. Diffusionsgewichtete Kernspinsequenzen sind bei der Differenzialdiagnose hilfreich, da die Diffusion in Epidermoiden vermindert ist.
Die CT hat aber im Bereich des Kleinhirnbrückenwinkels immer noch eine wichtige Funktion, um die genaue Infiltration bzw. Arrosion der ossären Strukturen zu definieren und den genauen Verlauf des Bulbus jugularis im Verhältnis zum Meatus acusticus internus darzustellen. Damit gehört die CT zur präoperativen Routine.
Die Angiographie ist präoperativ bei Glomustumoren und großen Meningeomen indiziert. Bei aktiver Perfusion soll bei diesen Tumoren präoperativ eine Embolisation diskutiert werden.
Elektrophysiologie
Eine Audiometrie, Vestibularisprüfung und ein Fazialis-EMG gehören zur präoperativen Routine. Bei großen Akustikusneurinomen und Glomustumoren soll neben einer genauen klinischen Beurteilung der kaudalen Hirnnerven auch eine Laryngoskopie durchgeführt werden, um eine etwaige Vagusparese (Stimmbandlähmung) zu erfassen. Diese Untersuchungen werden interdisziplinär in der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am UKM durchgeführt.
Operative Therapie
Nachsorge
Eine Baseline-MRT soll nach 3 Monaten durchgeführt werden. Bei benignen, radikalentfernten Tumoren soll eine Kontrolle nach 1,2 und 5 Jahren veranlasst werden. Bei inkomplett entfernten Prozessen soll bis zu 5 Jahren jährlich kontrolliert werden und anschließend dem Verlauf entsprechend individuell. Dies gilt auch für radiochirurgisch behandelte Fälle.
Leitung
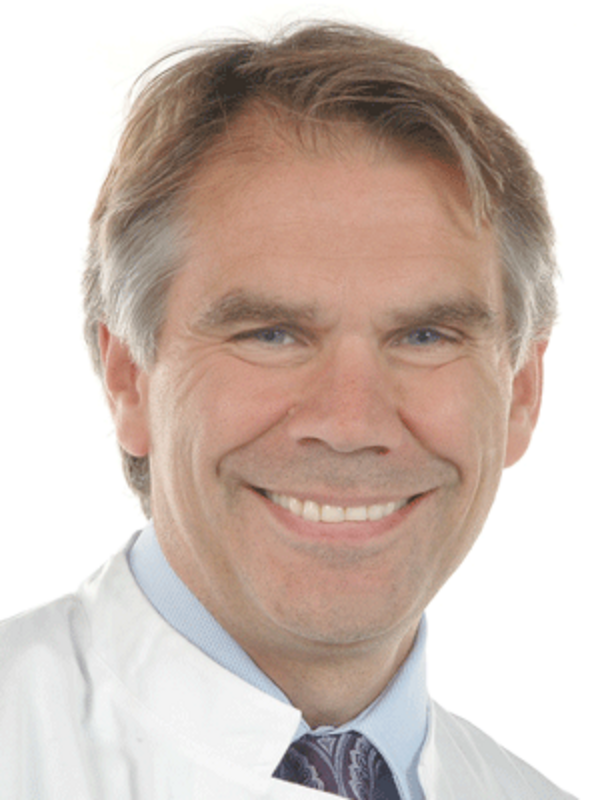
Univ.-Prof. Dr. med. Walter Stummer
Direktor Klinik für Neurochirurgie

Prof. Dr. med. Eric Suero Molina, MBA, FEBNS
Leitender Oberarzt
Klinik für Neurochirurgie
Albert-Schweitzer-Campus 1
Gebäude A1
48149 Münster

