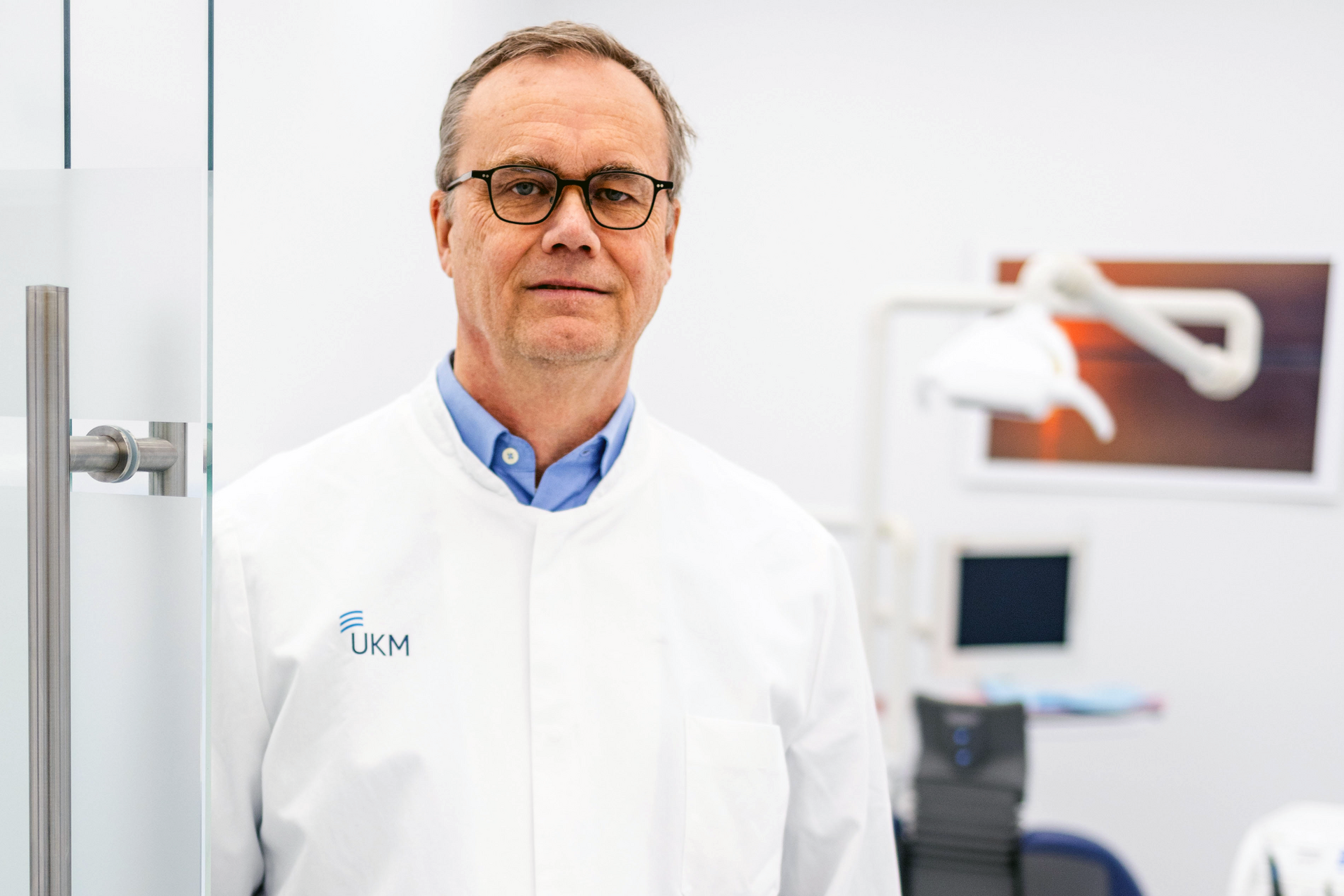Amalgam verschwindet aus den Zahnarztpraxen
Wenn es um Zahnfüllungen geht, war Amalgam Jahrzehnte lang der Standard, den auch Krankenkassen ihren gesetzlich Versicherten finanziert haben. Aus Umweltschutzgründen wird das Material ab 2025 verboten. Nebeneffekt: Amalgam verschwindet auch aus den Zahnarztpraxen. Dort war es dank vieler Alternativen zuletzt aber ohnehin nicht mehr sehr verbreitet, wie Prof. Dr. Till Dammaschke, Oberarzt in der Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung am UKM, im Interview erläutert. | lwi
Herr Prof. Dammaschke, was genau ist Amalgam eigentlich?
Prof. Dr. Till Dammaschke: Amalgame sind flüssige, knetbare oder feste Legierungen aus Quecksilber und weiteren Metallen. Historisch gesehen sind sie schon im 7. Jahrhundert in China zum Füllen von Zähnen beschrieben worden. In Deutschland sind handschriftliche Rezepturen seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Im 19. Jahrhundert startete die industrielle Herstellung von Amalgamen in den USA und Europa. Für zahnärztliche Zwecke kamen zuletzt Legierungspulver (Alloys) zum Einsatz, bei denen Quecksilber im Verhältnis 1:1 mit Silber (65 Prozent), Zinn (30 Prozent) und Kupfer (5 Prozent) vermischt wurde.
Was hat Amalgam lange so beliebt gemacht?
Dammaschke: Die relativ einfache Verarbeitung. Amalgam kann gut in Zahnform gebracht werden, erhärtet innerhalb von Minuten und ist auch als nicht so perfekt gelegte Füllung relativ lange haltbar. Zudem funktioniert die Aushärtung auch im feuchten Mundmilieu, also etwa unter Zutritt von Speichel oder Blut.
Wie verbreitet ist Amalgam noch?
Dammaschke: Im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe ist der Anteil der gelegten Amalgamfüllungen in den Jahren 2021 bis 2023 von etwa 3,5 auf 1,4 Prozent zurückgegangen. Deutschlandweit bestehen wohl nur zwei bis drei Prozent der neu gelegten Füllungen aus Amalgam. In der Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung am UKM verarbeiten wir seit etwa zehn Jahren kein Amalgam mehr. Auch in der Lehre spielt das Material für die Studierenden keine Rolle mehr.
Warum gibt es dann jetzt überhaupt das Verbot?
Dammaschke: Zunächst muss hier betont werden, dass Amalgam aus Umweltschutzgründen verboten wird. Die EU und viele weitere Staaten wollen mit der „Minamata-Konvention“ die Quecksilberemissionen in die Umwelt reduzieren. Amalgamfüllungen sind weiterhin gesundheitlich unbedenklich, auch dann, wenn sie verschluckt werden sollten. Gesundheitlich belastend können nur die Quecksilberdämpfe sein, die beim Legen oder Herausbohren der Füllung entstehen. Diese werden heutzutage aber durch Absauganlagen abgesaugt. In Deutschland sind zudem alle Zahnarztpraxen mit Amalgamabscheidern ausgestattet, so dass hier eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet wird.
Was gab und gibt es jetzt für Alternativen?
Dammaschke: Grundsätzlich sind Komposite, häufig auch als Kunststofffüllungen bezeichnet, die Alternative. Kommen hier solche zum Einsatz, für die der Zahn zunächst (mit Dentinadhäsiven) vorbehandelt werden muss, damit sie haften, sind diese so haltbar wie Amalgamfüllungen. Dafür ist allerdings eine Zuzahlung nötig. In die Regelversorgung der Krankenkassen kommen hingegen nur „selbstadhäsive“, also selbsthaftende Materialien wie beispielsweise Glasionomerzemente (GIZ) oder Kunststoff-modifizierte Glasionomerzemente (KM-GIZ). Diese stellen für sich allein genommen aber keinen gleichwertigen Ersatz für Amalgam dar, weil ihre Haltbarkeit und die Erfolgsraten zumeist geringer sind.
Wie beurteilen Sie das Verbot aus medizinischer Sicht?
Dammaschke: Die Zahl der gelegten Amalgamfüllungen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, da glücklicherweise die Kariesprophylaxe greift und insgesamt weniger Füllungen gelegt werden müssen. Zudem besteht seitens der Patientinnen und Patienten schon seit längerem der Wusch nach „zahnfarbenen“ Restaurationen. Insofern hat sich die minimalinvasive Kompositfüllung längst etabliert. Leider gibt es Patientinnen und Patienten, die weiterhin auf eine zuzahlungsfreie Regelversorgung angewiesen sind, und denen nun statt Amalgam nur selbstadhäsive Materialien zur Verfügung stehen.
Kontakt für Presseanfragen